Der Winter hat noch nicht einmal begonnen, doch schon jetzt steigen die Corona-Infektionszahlen massiv an. Über 270 Kreise gelten mittlerweile als Risikogebiete und die Lock-Downs, die in Berchtesgaden und Rottal-Inn bereits verhängt wurden, könnten noch mehr Regionen treffen.
Das Frühjahr hat gezeigt, dass solche Kontaktverbote die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen besonders hart treffen und der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, betonte vor Kurzem, dass es auf keinem Fall nochmals zu einer monatelangen Isolation kommen darf. Auch Kanzlerin Angela Merkel und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sind gegen flächendeckende Besuchsverbote und zu restriktive Einschränkungen vonseiten der Altenheime.
Mittlerweile versteht die Wissenschaft COVID-19 besser und Institutionen wie das Robert-Koch-Institut (RKI) geben spezielle Handlungsanweisungen für Pflegeheime vor. Darin heißt es, dass die Bewohner in festen Kleingruppen betreut werden sollten, dass das generelle Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes durch das Personal empfohlen wird und soziale Kontakte möglichst über Telekommunikation erfolgen sollen.
Allerdings gibt es Experten, die auf die gesundheitlichen Folgen der strengen Maßnahmen für die Heimbewohner hinweisen. Auch Pflegekräfte berichten häufiger von einer Zunahme von Depressionen, Verwirrtheit und körperlichem Abbau.
Jeder Landkreis hat eigene Regeln
Die Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft plädiert in einer eigenen Leitlinie zum Beispiel dafür, die Empfehlungen des RKI in einigen Punkten etwas zu lockern, um den sozialen Bedürfnissen entgegenzukommen, aber dennoch den hohen Stellenwert des Infektionsschutzes zu wahren.
Ein Flickenteppich aus Maßnahmen, Regeln, überall Unklarheiten und dazu eine riesige Verantwortung. Das alles erlebt Susanne Lickert gerade am eigenen Leib. Sie ist Leiterin des Seniorenzentrums "An der Sulzach". Die Einrichtung gehört zu einer GmbH mit sechs Häusern in verschiedenen bayerischen Regierungsbezirken.
"Wir unterliegen den Gesundheitsämtern und jedes Gesundheitsamt hat seine eigene Linie. Bei uns in Mittelfranken ist die Regelung zum Beispiel deutlich strenger, als bei meinen oberbayerischen Kollegen", berichtet sie.
Lickert hatte damals schon vor Beginn des Lock-Downs entschieden, "das Haus partiell zu schließen, weil wir die Gefahr im Februar schon gesehen haben." Keine leichte Entscheidung. "Unser Haus ist sehr offen, normalerweise sind den ganzen Tag viele Besucher da."

Zwar dürfen die Besucher, nachdem sie ihre Angehörigen anfangs nur im umfunktionierten Personalraum treffen durften, mittlerweile wieder auf die Zimmer. Doch ohne Termine geht nichts. Diese sind bei 78 Bewohnern nicht einfach zu koordinieren und die täglichen Zeitfenster von einer Stunde sind für viele Angehörige schwer mit dem Alltag zu vereinbaren.
"Meine Tochter ist nach der Arbeit oft bei mir vorbeigefahren. Die Termine kann sie schwierig wahrnehmen, weil sie in ihrer Arbeitszeit liegen", bedauert der 84-jährige Wilhelm Hoffmann.
Eine Mitarbeiterin ist allein für den Besuchsdienst abgestellt. Den ganzen Tag lang holt sie Besucher ab, misst Fieber, dokumentiert alles und bringt sie auf die Zimmer und wieder zurück.
Während viele andere Häuser sich im Sommer wieder für freien Besuch geöffnet hatten, entschloss sich Susanne Lickert, ihr strengeres, aber beständiges Konzept beizubehalten. Das hat sich ausgezahlt: "Gesundheitsamt und Heimaufsicht sagen, unser Konzept hat uns den Kopf gerettet. In den anderen Heimen gibt es jetzt immer mehr Fälle und bei uns ist noch nichts."
Die Senioren haben mehr Verständnis, als die Angehörigen, die oft mit ihr diskutieren oder sich einfach nicht an die Regeln halten. "Wir erleben, dass ein Besucher einen Bewohner abholt und hinter der Hecke stehen fünf Familienangehörige, die sich die Maske runterreißen und die Oma herzen. Wir haben einen offenen Hof mit freiem Zugang zu unserem Garten. Da haben sich die Leute reingeschlichen - wir mussten ein Hoftor anbauen", erzählt sie.
Obwohl sie täglich dutzende Mails und Anrufe beantwortet und trotz ihres Urlaubs - der erste dieses Jahr - immer präsent sein muss, wirkt sie wie jemand, der nie die Geduld verliert. "Wir geben jeden Tag unser Bestes", erklärt sie schlicht. Sie bereitet sich mit einem neuen Hygienekonzept lieber pragmatisch auf die Erkältungszeit vor, statt über eine Krise zu jammern, an der sie nichts ändern kann.
Kampf gegen die Einsamkeit
Sie ist stolz auf ihre Mitarbeiter und hat die soziale Betreuung durch Ehrenamtler ausgebaut, um der Vereinsamung entgegenzuwirken. Petra Stohr leitet das Team. Die vielen Einschränkungen, die Corona mit sich bringt, machen ihre Arbeit nicht gerade einfach.
"Für uns ist das Schlimmste, dass all das, was wir hier in mühseliger Arbeit mit den Bewohnern aufgebaut haben, auf einmal weggebrochen ist. Überall muss man sagen, ‘tut mir leid, das geht nicht mehr’." Nicht einmal gemeinsam singen dürfen sie - zu wenig Abstand, zu viele Aerosole.
"Viele Bewohner haben sich auf das Heim gefreut, weil sie gehört haben, dass es Tanzcafés, Parties und Musikantenstadl gibt. Und jetzt kommen sie hier rein und kriegen gar nichts mehr geboten", sagt die 57-Jährige. "Manche sagen, ‘dann ist es besser, wenn mich der liebe Herrgott heute holt. Vielleicht habe ich nur noch ein Jahr zu leben, ich will einfach ein bisschen Lebensfreude’."
Ein Pflegeheim ist für viele Menschen eben nicht die "Endstation", sondern bietet ihnen eine neue Gemeinschaft, die sie zu Hause nicht mehr erleben konnten. "Wir haben ein belebtes Haus gehabt, dafür sind wir bekannt", sagt Petra Stohr stolz. "Leute, die zu Hause isoliert waren, weil keiner Zeit für sie hatte, sind hier aufgewacht und haben wieder teilgenommen."
Jetzt dürfen sich im Heim nur noch Senioren der gleichen Wohngruppe begegnen, es sei denn, sie gehen in den Garten. "Aber jetzt kommt der Winter", sagt Herr Hoffmann. Er vermisst seine Bekannten aus dem zweiten Stock. "Ich kann mich mit fast gar nichts beschäftigen, weil ich fast nichts mehr sehe. Mir bleibt nur die Unterhaltung."
Kleine Kompromisse
Andreas Meier, Anfang 60, hat auf der Suche nach Beschäftigung mit dem Malen angefangen. "Jetzt hängen im Gang schon neun Bilder von mir." Den Corona-konformen Spielen, bei denen zum Beispiel die Bälle nach jedem Spielzug desinfiziert werden müssen, kann er nicht soviel abgewinnen. "Den Großteil verbringt man mit Warten und das ist auch nicht Sinn der Sache. Aber viele nehmen das gerne an, weil sie sonst gar nichts zu tun hätten und dann wird man ja trübsinnig."
Um dem vorzubeugen, verzichten die Pfleger im Heim auch nicht vollkommen auf Körperkontakt, der über die Grundpflege hinaus geht. "Basale Stimulation und Berührungen sind extrem wichtig", sagt Frau Lickert. Deshalb werden zum Beispiel weiter Handmassagen durchgeführt. Sich strikt an die Empfehlungen des RKI zu halten, ist eben schwierig, auch was die Atemschutzmasken betrifft.
"Bei denen, die schlecht hören, ist der Mundschutz ein Problem", gibt Herr Hoffmann zu bedenken. Susanne Lickert findet, "man kann auch mal die Maske abnehmen, damit die dementen Bewohner die Mimik sehen. Man muss eben Abstand halten."
Ihren Wunsch, "dass es nicht so unterschiedliche Regelungen gibt und dass sie transparenter sind", scheint die Politik immerhin zu erhören. Andreas Westerfellhaus möchte den Einrichtungen noch vor Weihnachten mit Unterstützung des RKI und des Gesundheitsministeriums eine einheitliche und nachvollziehbare Handreichung vorlegen. Auch Corona-Schnelltests sollen baldmöglichst zur Verfügung stehen.
Es mag paradox klingen, aber einen Vorteil haben die strengen Hygieneregeln für Susanne Lickert immerhin: "Ich hatte in der Zeit seit März noch nie so wenig kranke Bewohner und Mitarbeiter."
Friederike Bloch




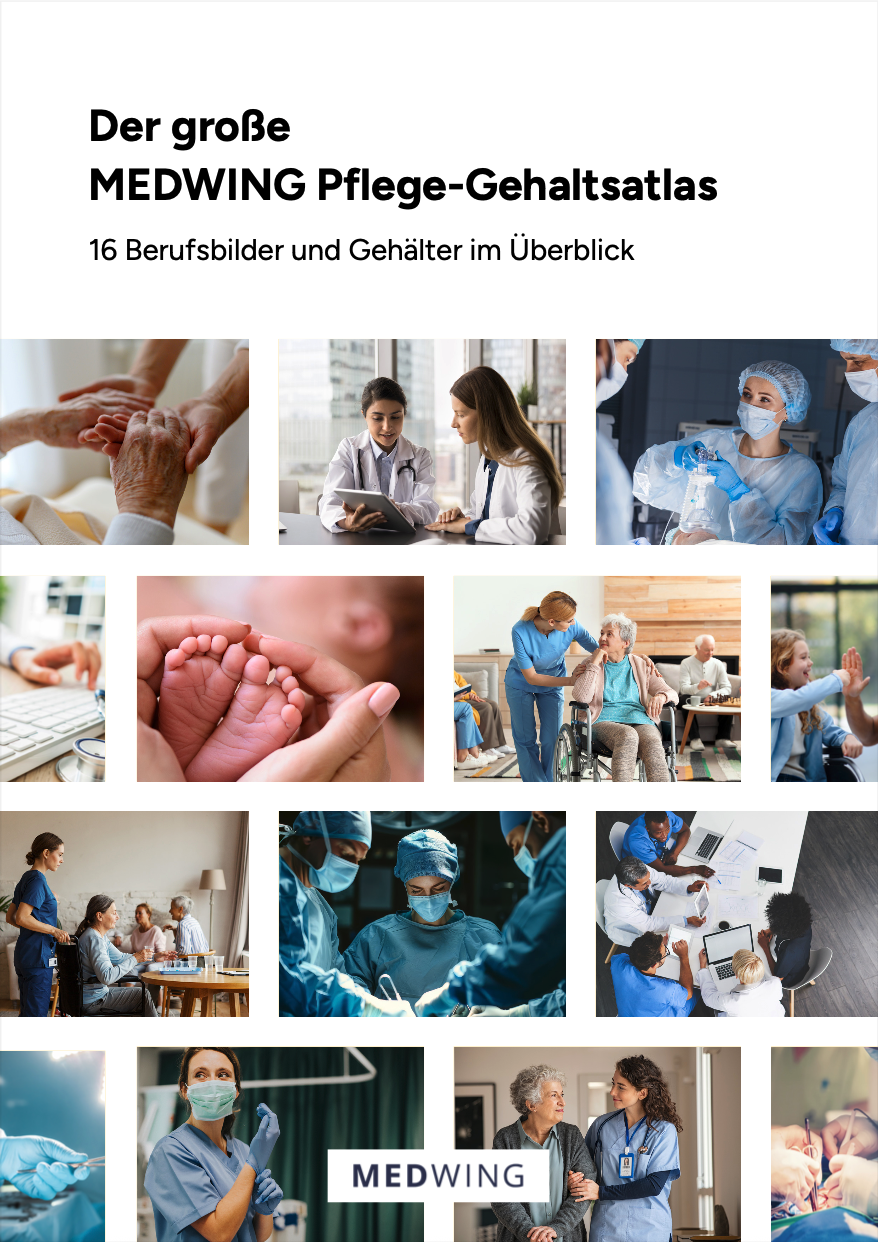
%20(1).png)












.png)