
Die PSU Helpline bietet telefonische Beratung für Gesundheitspersonal in Belastungssituationen. Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin erklärt im Interview, wie sie den Betroffenen hilft und welche neuen Probleme mit der Corona-Pandemie dazugekommen sind.
Unerwartete Todesfälle, komplizierte Operationen, schwere Diagnosen – emotionale Belastungen gehören für Pflegekräfte und Ärzt:innen zum Beruf. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie spurlos an ihnen vorübergehen, vor allem seit die Corona-Pandemie auf manchen Stationen zu permanenten Ausnahmesituationen führt. Innerhalb der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen gibt es allerdings kaum psychologische Unterstützung für das überlastete Gesundheitspersonal.
Der Münchener Verein PSU-Akut ist eine externe Anlaufstelle für Beschäftigte im Gesundheitswesen, die Schwierigkeiten haben, Stress oder schwerwiegende Ereignisse zu verarbeiten. PSU steht für Psychosoziale Unterstützung, die der gemeinnützige Verein anbietet, unter anderem durch die PSU Helpline. Der kostenlose und anonyme Telefondienst wird von geschulten, ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen betrieben, die selbst aus dem Gesundheitsbereich kommen. Eine von ihnen ist Ivonne Mohr. Die ausgebildete Intensivpflegerin und Pflegepädagogin arbeitet regelmäßig für die Helpline. Im Interview erklärt sie, warum es mehr Hilfsangebote für Pflegekräfte und Ärzt:innen geben muss und warum sich mit den Corona-Wellen auch der Gesprächsbedarf ändert.
Wie sieht Ihre Arbeit bei der PSU Helpline aus?
Ivonne Mohr: Wenn jemand bei der Helpline anruft und zu mir durchgestellt wird, stelle ich mich vor und frage, was ich für sie oder ihn tun kann. Meistens sprudelt es da schon heraus und ich höre zu. Während die Person erzählt, sortiere ich im Kopf, was das schwerwiegende Ereignis ist und welche Rolle sie hatte. Ich war ja 30 Jahre in der Pflege und habe so viel gesehen und erlebt, dass ich mich meist gut hineinversetzen kann. Dann versuchen wir gemeinsam, das Gefühlschaos und die Belastungen zu strukturieren. Ich schaue, welche Ressourcen und Strategien die Person hat, um diese Situation zu bewältigen. Wichtig ist, dass man es nicht pathologisiert oder stigmatisiert. Ich vermittle, dass es völlig normal ist, nicht schlafen zu können oder sich immer wieder daran zu erinnern.
Welche Ratschläge geben Sie den Anrufer:innen?
Ivonne Mohr: Was sie machen können, damit sie wieder schlafen können, zum Beispiel. Wenn derjenige sagt, ich muss ständig grübeln und finde keine Ruhe, gibt man ihm Techniken an die Hand, wie den Grübelstuhl.
Was ist das?
Ivonne Mohr: Wenn man ins Bett geht und anfängt zu grübeln, soll man bewusst aufstehen und sich auf einen Stuhl oder Sessel setzen, aber nicht unbedingt an den Lieblingsplatz. Man sagt sich, jetzt grübel ich. Dann muss man wieder ein Ende finden – jetzt habe ich mich damit auseinandergesetzt und gehe schlafen. Das muss man am Anfang ganz oft machen, aber irgendwann funktioniert es. Oder die Tresortechnik. Man legt ein Sorgenbuch an, schreibt die Erlebnisse auf und schließt es weg, um sich dann wieder dem Alltag widmen zu können.
Wie hat sich der Gesprächsbedarf der Ärzt:innen und Pflegekräfte seit der Corona-Pandemie verändert?
Ivonne Mohr: Durch COVID-19 hat es sich wahnsinnig potenziert, weil sämtliche Einrichtungen des Gesundheitswesens mit der Corona-Pandemie in Verbindung kamen. Es sind Situationen der Ohnmacht entstanden, auf die sich der Gesprächsbedarf verlagert hat. In der ersten Welle war es die Angst, sich selbst oder die Familie anzustecken, teilweise wurden Pflegekräfte von ihrem Umfeld stigmatisiert. Oder die fehlende Schutzausrüstung. Und dann das Sterben, vor allem in den Altenheimen. Wenn der Versorgungs- und Fürsorgeauftrag für die Bewohner:innen verloren geht, weil man gar nicht mehr in die Zimmer gehen kann. Das hat die Menschen sehr beschäftigt und belastet. In der zweiten Welle sind Ärzt:innen und Pflegekräfte sind an ihre Grenzen gekommen. Sie haben diese vielen Tode erlebt und sich total allein gefühlt. Die Zündschnur wurde immer kürzer und im Team kam es zu Konflikten. Mittlerweile geht es oft darum, dass die Patient:innen, die beatmet werden, meist ungeimpft sind und sie Menschen versorgen müssen, die nicht an Corona glauben.
Was machen Sie, wenn die Betroffenen mehr brauchen, als ein Helpline-Gespräch?
Ivonne Mohr: Wenn ich das Gefühl habe, dem Menschen reicht meine kollegiale Unterstützung nicht, kann ich ihn an eine Fachkraft weiterleiten. Wir haben auch eine psychotherapeutische Sprechstunde, die man kontaktieren kann. Das Schöne an der Helpline ist ja, dass man anonym bleiben kann, ohne dass man gleich zu einem Psychologen oder Arzt geht oder einen Stempel aufgedrückt kriegt. Davor haben die meisten Angst, dass man sagt, der ist krank.
Für viele emotional belastende Berufe gibt es gut ausgebaute Netzwerke zur psychosozialen Unterstützung. Gesundheitspersonal dagegen fühlt sich oft alleingelassen. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ivonne Mohr: Ich bin seit 1991 in der Pflege und ich kann Ihnen nicht sagen, warum wir jetzt erst anfangen, uns so zu unterstützen. Hygiene, Medizinprodukte – wir haben in den Kliniken für alles einen Beauftragten. Nur für unsere psychische Gesundheit nicht. Als ich angefangen habe, gab es zumindest die Chance, die Erlebnisse im Team zu besprechen oder auch mal jemanden aus dem Dienst herauszunehmen. Mit der Arbeitsverdichtung und dem Fachkräftemangel geht das gar nicht mehr. Alle müssen funktionieren und es wird über nichts mehr geredet. Dass es für Pflegekräfte keine Kriseninterventionsteams wie für Feuerwehrleute oder U-Bahn-Fahrer:innen gibt, rührt wahrscheinlich auch von unserer Geschichte her und dem altruistischen Gedanken der Medizin und Pflege. Ich habe früher auch Sprüche gehört wie: Das musst du schon aushalten, du musst ein dickeres Fell kriegen. Aber wir brauchen einen professionellen Umgang mit solchen Situationen, damit wir nicht ausbrennen und gesund bleiben.
Warum wiegen manche Ereignisse schwerer als andere, obwohl Pflegekräfte und Ärzt:innen in ihrem Beruf vielleicht schon „Schlimmeres“ erlebt haben?
Ivonne Mohr: Es kommt darauf an, wie voll mein „Rucksack“ schon ist und ob ich psychisch stabil und gesund bin. Als Mutter von zwei Kindern kann ich sagen, ich habe Adrenalinschübe bekommen, wenn ich im Schockraum stand und es hieß, es kommt ein Kind. Wenn man ein Bild dazu hat und die emotionale Komponente hinzukommt, wird das Ereignis zu einem Ballast.
Was müsste passieren, damit weniger Gesundheitspersonal die Helpline in Anspruch nehmen muss?
Ivonne Mohr: Aufgrund unseres Gesundheitssystems und wie es sich verändert, wird es wohl eine Konstante bleiben. Aber es müsste in die Häuser und gehört als Grundbaustein in jede pflegerische und medizinische Ausbildung. Dort müsste man präventiv schulen, wie man mit schwerwiegenden Ereignissen umgeht, was normal ist und wann man sich professionelle Hilfe holen sollte. In jedem Krankenhaus und Pflegeheim sollten vor Ort ausgebildete Peers zur Verfügung stehen.
Häufig Krisensituationen zu erleben bedeutet nicht, dass man automatisch mit allem umgehen kann. Im Gegenteil – auch die Helfer:innen brauchen Hilfe, um Belastungsreaktionen und Burnouts vorzubeugen. Bei der PSU Helpline finden Mitarbeiter:innen medizinischer und pflegerischer Einrichtungen die kollegiale und psychosoziale Unterstützung, die vor Ort leider oft fehlt. Du erreichst die Helpline täglich von 9:00 bis 21:00 kostenfrei unter 0800 0 911 912.Weitere Informationen sowie einen Fragebogen zur Einschätzung der eigenen Belastung findest du unter psu-helpline.de.
Interview & Text: Friederike Bloch




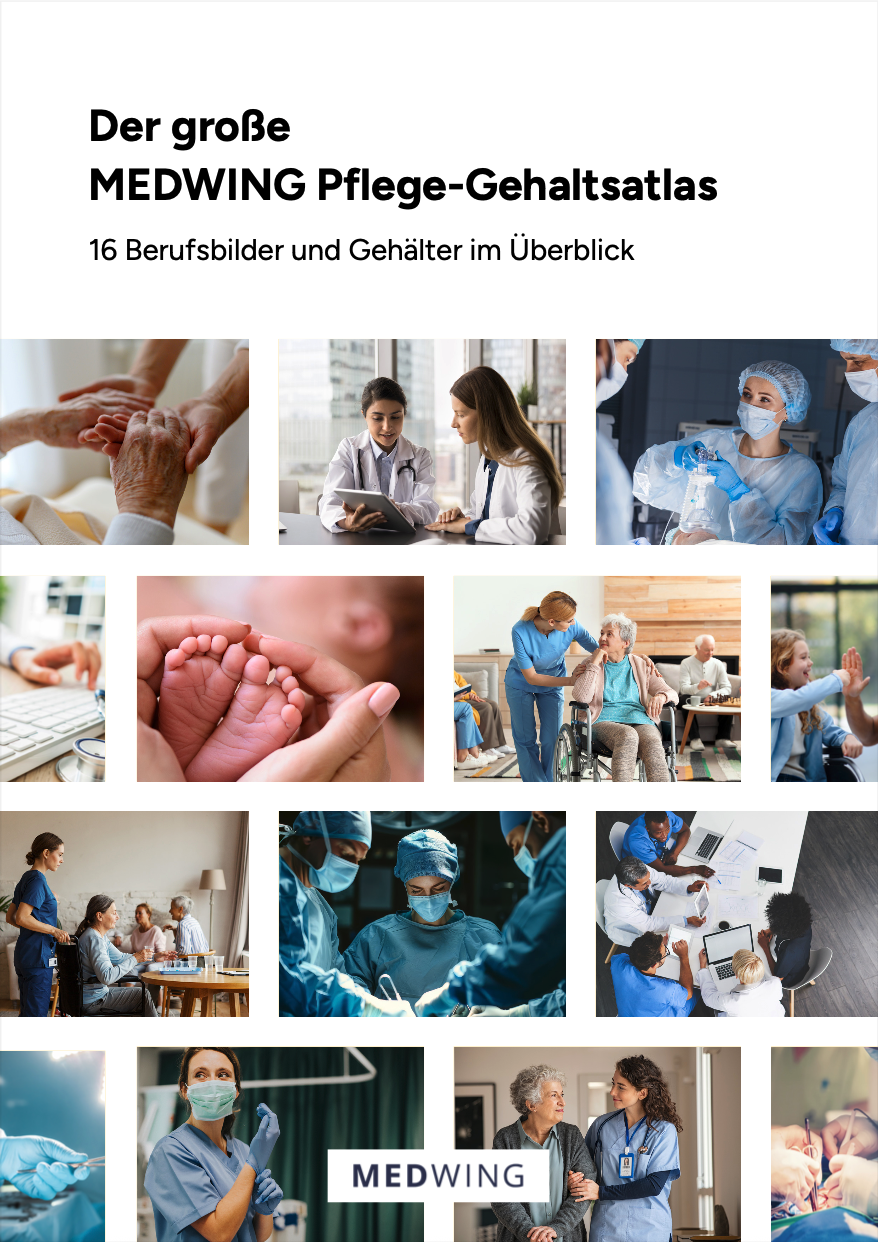
%20(1).png)












.png)