
Wer in der Pflege arbeitet, hat sich für einen Beruf entschieden, in dem emotional belastende Situationen zum Alltag gehören. Pflegekräfte brauchen „ein dickes Fell“ heißt es oft, doch gleichzeitig sollen sie empathisch sein und immer zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wird. Dieses Dilemma bildet den Nährboden für eine psychische Langzeitbelastung, deren Folgen von Erschöpfung und Frustration bis hin zu Depressionen oder Burn-Out reichen. Viele Kliniken und Pflegeeinrichtungen bieten ihren Mitarbeitern deshalb Supervision an – eine Praxis der Sozialarbeit, die es in ihrer frühen Form schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts gibt.
Guido Laschet hat miterlebt, wie sich die Supervision vor über 30 Jahren in den Gesundheitsberufen etabliert hat. Der 65-Jährige war selbst Krankenpfleger, Stationspfleger und Lehrer für Pflegeberufe, als er sich in den 80er Jahren für eine Weiterbildung zum Supervisor entschloss. Mit einem Partner gründete er schließlich das Bildungsinstitut „perspektive PERSONALENTWICKLUNG“, das Fort- und Weiterbildungen im Gesundheitswesen anbietet. Er selbst ist mittlerweile aus Altersgründen ausgeschieden, aber weiterhin regelmäßig als Supervisior tätig. Im Interview erzählt er, warum es für Supervision eine Person von außen braucht und was es mit Pflegekräften macht, wenn sie ihre Belastungen mit nach Hause schleppen.
Herr Laschet, was genau ist Supervision?
Es ist eine berufsfeldbezogene Reflexion und eine Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Angelegenheiten, in denen es gerade hakt. Es ist sozusagen ein Draufblick von oben. Wenn Sie selber im Problem drinhängen, haben Sie nicht die nötige Distanz, um es analysieren und lösen zu können. Eine Person, die neutral von außen kommt, sieht Dinge, die man selber nicht mehr sehen kann.
Für wen eignet sich Supervision?
Im Grunde für jeden. Es unterstützt präventiv, im Pflegebereich vor allem auf Palliativ-, Onkologie-, Neonatologie- und Intensivstationen, sowie in der Psychiatrie. Dort gibt es seit Jahren schon systematisch Supervision und teilweise steht auch im Arbeitsvertrag, dass sich die Mitarbeiter:innen verpflichten müssen, regelmäßig an der angebotenen Supervision teilzunehmen. Manchmal findet sie alle vier Wochen statt, manchmal einmal im Quartal.
Was ist der Unterschied zur psychologischen Beratung?
Supervision ist keine Therapie. Ich bin kein Therapeut, ich habe auch nicht die Qualifikation dazu. In dem Moment, in dem ich den Eindruck habe, dass ein:e Supervisant:in eine Therapie braucht, empfehle ich, eine Psychologin oder einen Psychologen aufzusuchen.Das passiert tatsächlich immer mal wieder. Der Arbeitgerberin oder dem Arbeitgeber fällt ein:e Mitarbeiter:in zum Beispiel auf und schlägt vor, eine Supervision zu machen. Manche Arbeitgeber:innen scheuen sich, gleich zu sagen „Machen Sie eine Therapie“, denn das dürfen sie eigentlich auch nicht. Ich stelle dann fest, die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter ist nicht in der Lage, Verantwortung für sich zu übernehmen oder hat massive persönliche Sorgen und Symptome, die zum Beispiel auf eine Depression hindeuten.
Dem soll die Supervision vorbeugen. Warum ist das gerade im Pflegebereich von so großer Bedeutung?
Durch den zunehmenden Personalmangel und die Arbeitsdichte ist oft keine Zeit mehr, sich nach dem Dienst zusammenzusetzen und sich auszutauschen. Dann nehmen die Pflegekräfte die Belastung mit nach Hause, wo sie sich oft noch zusätzlich um Kinder und Familie kümmern und es auch nicht richtig verarbeiten können. Sie schleppen diese Belastung mit sich rum. Für die Psychohygiene ist es daher wichtig, dass sie diesen Lastenrucksack hin und wieder ausleeren können. Sie besprechen die Belastungen bei der Arbeit, wo sie entstehen und können sie auch dort lassen.
Warum hilft es allein schon, darüber zu reden?
Geteiltes Leid ist halbes Leid. Es hilft, mitzukriegen, dass es anderen auch so geht. Es ist beruhigend für die Pflegekräfte zu wissen, dass es normal ist, was sie erleben und dass sie nicht „komisch“ sind. Das andere ist: Auskotzen tut einfach gut. Das löst natürlich die Probleme noch nicht, deshalb ist der nächste Schritt, über Lösungsansätze zu reden und zu überlegen, wie man die Problemthemen angeht.
Welche Themen werden zum Beispiel angesprochen?
In meinen Einzelsupervisionen geht es meistens um Führungsthemen. Sie werden mittlerweile oft Einzelcoaching genannt. Ich habe das Gefühl, Supervision hat den Ruf, dass etwas nicht stimmt und Coaching hört sich für die Führungskräfte eher nach Unterstützung und Management an.Ich trainiere mit ihnen auch oft Konfliktgespräche und stelle mich als Rollenspielpartner zur Verfügung. Oder wir bereiten ein Trennungsgespräch vor, wenn sich zum Beispiel ein:e Pflegebereichsleiter:in von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter trennen muss. Es kann auch um organisatorische Dinge gehen, wenn ein Bereich neu strukturiert wird oder Stationen zu Bereichen zusammengelegt werden. Diese Veränderungsprozesse sind sowohl für Leitungen als auch für Teams eine große Herausforderung.In Team-Supervisionen bespreche ich mit dem kompletten multiprofessionellen Team die Arbeit in psychisch anstrengenden Bereichen.Dann gibt es auch Gruppen-Supervision, in denen sich zum Beispiel alle Stationsleitungen eines Hauses austauschen können. Das ist gut, denn auch wenn die Leitung in der Team-Supervision mitmacht, werden bestimmte Leitungsthemen dort eher selten angesprochen. Es kommen auch immer wieder Fallbesprechungen vor, in denen die Beziehung zwischen dem therapeutischen Team und einer Patientin oder einem Patienten reflektiert wird.
Wo finden die Sitzungen statt und wie lange dauern sie?
Zu 95 Prozent in den Einrichtungen selbst, zum Beispiel in den Gruppenräumen. Ganz selten wünschen sich Führungspersonen für eine Einzelsupervision zu mir zu kommen, um sie außerhalb des Arbeitsplatzes durchzuführen.Team-Supervisionen dauern in der Regel eineinhalb Stunden, für Einzelsupervisionen vereinbare ich meistens eine Stunde.
Mit welcher Zielsetzung gehen Sie an Ihre Supervisionen heran?
Die klassische Frage des Supervisors ist: Worüber möchten Sie heute gerne reden? Mein Ziel ist, dass alle zu Wort kommen, dass eine gute Gesprächsatmosphäre entsteht und dass es für jedes Thema ausreichend Zeit gibt. Es geht darum, gemeinsam und lösungsorientiert zu reflektieren und dass ich Aspekte einbringe, an die die Teilnehmer:innen vielleicht nicht gedacht haben. Wenn wir die Lösung haben, frage ich, welche Schritte müssen gegangen werden, um dieses Ziel zu erreichen.
Gibt es keine Hemmschwelle, die Probleme überhaupt anzusprechen?
Bei Teams, die neu anfangen und keine Erfahrung mit Supervision haben, ist das oft so. Da muss ich ein, zwei Sitzungen verwenden, um eine Vertrauensbasis aufzubauen. Dann merken die Leute, das tut ja gar nicht weh, mir passiert hier gar nichts.
Was empfehlen Sie Belegschaften, die mit Supervision beginnen möchten?
Ich empfehle, zwei bis drei Supervisor:innen auszuprobieren, auch Frauen und Männer. Viele bieten kostenlose Kennenlernrunden oder Probesitzungen an. Die Chemie muss stimmen.In vielen Einrichtungen gibt es bei der Klinikleitung, in der Abteilung für Weiterbildung oder im Fortbildungsprogramm bereits Listen mit möglichen Supervisor:innen. In den meisten Fällen wird es als Arbeitszeit angerechnet und die Kosten übernommen.

Sie haben über 30 Jahre Erfahrungen als Supervisor. Was sind die häufigsten Probleme des Pflegepersonals?
Am meisten geht es um die professionellen Beziehungen im Team, den Faktor Mensch. Die Pfleger:innen arbeiten mit so vielen verschiedenen Menschen und Persönlichkeitstypen zusammen. Dass die Leute menschlich sein sollen, wird ja für die Arbeit auch gefordert, aber das führt eben auch zu Reibungen. Thema ist auch immer wieder das Verhältnis zwischen Mitarbeiter:innen und Vorgesetzten bzw. zwischen Pflegekräften und Ärzt:innen. Dieses Jahr war natürlich Corona ein weiteres Thema, das viel Unruhe und emotionale Belastung mit sich gebracht hat, weil zum Beispiel Personal für Coronastationen abgezogen wurde und die Patient:innen keinen Besuch mehr empfangen konnten.
Gibt es auch Probleme, die man nicht lösen kann?
Ja. Zum Teil, weil sie zu spät angegangen werden und sich die Fronten so verhärtet haben, dass auch die beste Supervisorin und der beste Supervisor nichts mehr machen kann. Weil die Parteien nicht mehr miteinander reden wollen und keine Zugeständnisse mehr machen. Aber ein:e Supervisorin kann meistens immerhin für eine einigermaßen sozialverträgliche Trennung sorgen und zum Beispiel eine Versetzung anregen.
Was sind für Sie besondere Fälle oder Momente?
Ein herausforderndes Thema ist der Suizid von Patient:innen, zum Beispiel in psychiatrischen Einrichtungen. Einen Menschen, der sich das Leben genommen hat, vorzufinden, ist eine extreme Belastung. Oder der Tod eines Kindes. Es tut den Mitarbeiter:innen gut, darüber zu reden, da wird auch geweint und Emotionen dürfen frei herausgelassen werden. Letztes Jahr hatte ich ein Team, in dem ein geliebter Kollegen gestorben ist, was alle erschüttert hat. Wir haben die gemeinsamen Jahre Revue passieren lassen, sie haben sich auch an lustige Situationen erinnert und dann wird sogar gelacht. Oder auch einfach nur, wenn eine unvermeidbare Trennung dann doch so abläuft, dass am Ende alle zufrieden sind. Das sind schöne Momente für mich.
Friederike Bloch




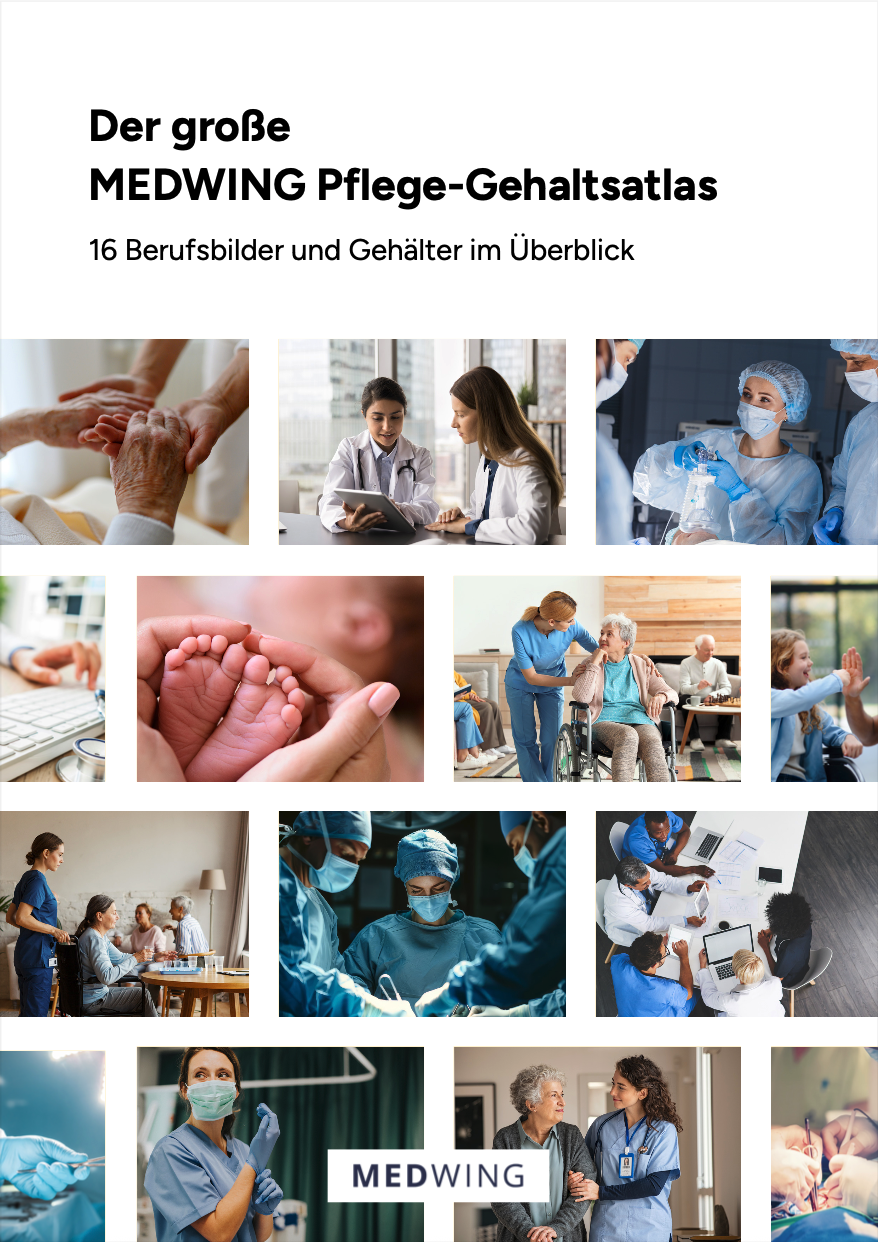
%20(1).png)












.png)