In Medizin und Forschung gilt der männliche Körper allzu oft als Norm. Für Frauen kann das lebensbedrohlich sein. Warum geschlechtsspezifische Medizin wichtig ist und was auch Pflegekräfte wissen sollten, liest du hier.
Wie bei jeder Wissenschaft geht es auch in der Medizin um Daten. Sie sind die Grundlage der Erforschung des menschlichen Körpers und seiner Gesundheit. Je mehr Daten erhoben werden, desto genauer wird das Bild, das dabei hilft, Krankheiten zu erkennen, zu behandeln und zu heilen. Doch diese Daten weisen Lücken auf, die knapp die Hälfte der Bevölkerung betreffen. Denn Frauen sind in vielen klinischen Studien massiv unterrepräsentiert.
Der Mann als Norm
Der typische Proband für die medizinische Forschung ist der weiße Mann oder in den Frühstudien die junge männliche Maus. Ein Grund dafür ist der Zyklus der Frau, der ihren Hormonspiegel stark schwanken lässt.
"Die Forscher wissen, der Zyklus interferiert mit der Arzneimittelwirkung und dann sagt man, das ist ja viel zu kompliziert, als dass man das erforschen kann", sagt Dr. Vera Regitz-Zagrosek. Sie ist Kardiologin und Professorin an der Charité Berlin und Mitbegründerin der Gendermedizin in Deutschland. Bis 2019 leitete sie das "Institute for Gender in Medicine" an der Universitätsklinik.
Die Gendermedizin wurde in den 1990er Jahren entwickelt und fokussiert sich auf die geschlechtsspezifische Erforschung und Behandlung von Krankheitsbildern. Genau dies ist der Wissenschaft allerdings oft zu teuer und aufwändig und die Präferenz für männliche Probanden wird unter anderem mit dem Verweis auf den Contergan-Skandal der 60er Jahre und der Notwendigkeit, ungeborenes Leben zu schützen begründet.
"Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, trotzdem wird es häufig als Ausrede genutzt", so Dr. Regitz-Zagrosek. "Die meisten Arzneimittel gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden an Menschen getestet, die über 60 Jahre alt sind und da ist Schwangerschaft nun wirklich kein Problem mehr. Natürlich ist es wichtig, dass man eine Schwangerschaft ausschließt, wenn man ein Arzneimittel testet, aber das ist ja möglich."
Wenn Frauen in Medikamentenstudien vertreten sind, dann werden die Medikamente oft nur dann getestet, wenn ihr Hormonspiegel am niedrigsten und dem männlichen Körper am ähnlichsten ist und "Medikamente, die an Tieren oder Probanden erforscht wurden, die keinen Zyklus haben, gibt man natürlich trotzdem Frauen, die einen Zyklus haben. Also das ist schon sehr schizophren", findet die Medizinerin.
Neben dem Hormonspiegel gibt es viele weitere geschlechtsspezifische Unterschiede, die mehr Berücksichtigung finden sollten, um beiden Geschlechtern die passende Therapie anbieten und Nebenwirkungen ausschließen zu können.
"Wir wissen, dass Medikamente bei Frauen anders oder stärker wirken als bei Männern oder manchmal eben auch schwächer. Bevor man das nicht untersucht hat, kann man eigentlich nicht sagen, welche Dosis ein Mann oder eine Frau braucht", gibt Dr. Regitz-Zagrosek zu bedenken. "Das ist in der ganzen Medikamentenentwicklung wichtig, zum Beispiel bei Blutdrucksenkern und Medikamenten gegen Herzschwäche. Da weiß man, dass die Frauen zum Teil eine andere Dosis brauchen würden, als die Männer. Man weiß auch, dass die Nierenfunktion bei kleinen älteren Frauen häufiger schlechter ist als bei Männern und dass deshalb die Arzneimittel langsamer ausgeschieden werden."
Das Hormon Östrogen erweitert die Blutgefäße und Frauen sind vor ihren Wechseljahren besser vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen geschützt. Testosteron dagegen zieht die Blutgefäße zusammen und erhöht das Risiko für junge Männer.
"Plötzlicher Herztod ist eher Männersache, Autoimmunerkrankungen wie Rheuma sind eher Frauensache", erklärt Dr. Regitz-Zagrosek. "Diese Dinge sind bekannt und trotzdem beachtet man sie zu wenig."
Herzinfarkte werden bei Frauen seltener erkannt
Nicht nur die Häufigkeit bestimmter Krankheiten, auch die Symptomatik ist unterschiedlich. Es wurde nachgewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Fehldiagnose nach einem Herzinfarkt bei Frauen um 50 Prozent höher ist, als bei Männern, denn im Lehrbuch steht laut der Kardiologin "nur das typische Symptombild des Mannes." Wer nur an Männern forscht, kann schlecht vorhersagen, wie ein weiblicher Körper reagiert.
Bei Männern äußert sich ein Herzinfarkt so, wie man es aus Filmen kennt: Schmerzen in der Brust und dem linken Arm. Frauen dagegen erleiden häufig Bauchschmerzen, Kurzatmigkeit und Übelkeit.
"Wir wissen auch, dass bei Depressionen häufiger das Beschwerdebild der Frauen im Lehrbuch steht und dass Depressionen bei Männern zu wenig und zu selten diagnostiziert werden", ergänzt Dr. Regitz-Zagrosek. Auch die "Frauenkrankheit" Osteoporose wird bei Männern seltener erkannt.
Eine geschlechtssensible Betrachtung der Krankheitsbilder und -symptome kommt also nicht nur Frauen zugute und sollte nicht nur in der Medizin, sondern auch in der Pflege eine Rolle spielen, schließlich sind Pflegefachkräfte maßgeblich an der Medikamentengabe beteiligt und in Krankenhäusern und Pflegeheimen oft die ersten, die mit Krankheitssymptomen konfrontiert sind.
Gleichbehandlung in der Medizin heißt auf jeden Unterschied zu achten
Zwar gab die WHO 2001 eine Empfehlung für eine geschlechtsspezifische Gesundheitsvorsorge heraus und die Europäische Zulassungsbehörde EMA fordert eine stärkere Berücksichtigung von Frauen in klinischen Studien.
Doch für Dr. Regitz-Zagrosek steht fest: "Es werden viel zu wenige Frauen in Studien eingeschlossen. Es sind jetzt gerade wieder wichtige Herz-Kreislauf-Studien publiziert worden, bei denen 80 Prozent der Probanden Männer waren." Sie würde sich wünschen, dass das Institut für Gendermedizin in seiner Form nicht einzigartig in Deutschland wäre und dass die Gendermedizin "in der ärztlichen Fort-und Weiterbildung eine Rolle spielt" und die Ärztekammern ihre Bedeutung anerkennen. Sie rät vor allem den Patientinnen sich zu informieren und ihre Ärzte zu fragen, ob bestimmte Medikamente und Maßnahmen auch an Frauen getestet wurden.
Während Geschlechtergerechtigkeit in den meisten anderen Lebensbereichen eine möglichst gleiche Behandlung von Männern, Frauen und allen, die sich nicht auf ein Geschlecht festlegen möchten, bedeutet, kann sie in der Medizin nur durch das Gegenteil erreicht werden: auf jeden Unterschied ganz genau zu achten.
Vanessa Winkler und Friederike Bloch




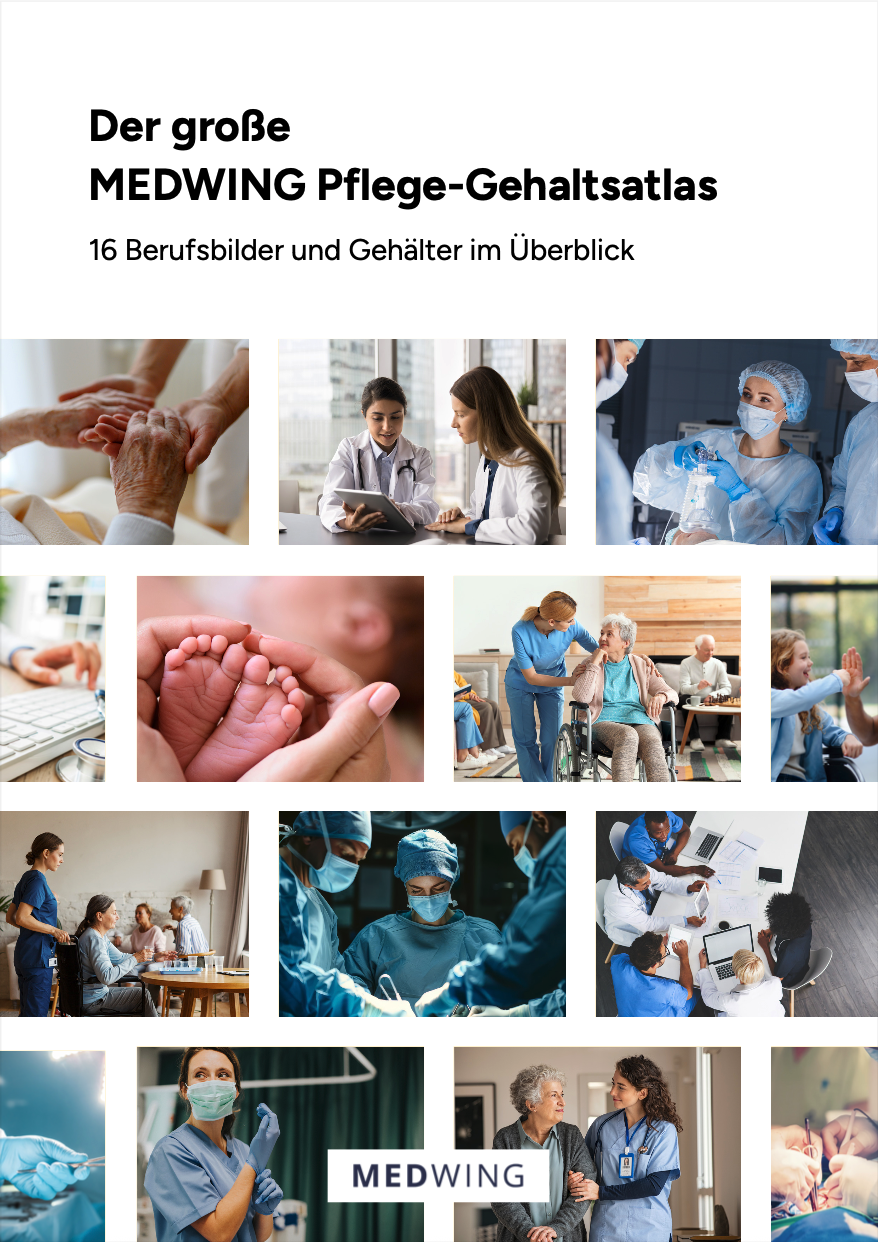
%20(1).png)












.png)