Am 3. Oktober feiern wir die Wiedervereinigung der Bundesrepublik Deutschland. Anlässlich des Tages der Deutschen Einheit wollten wir mehr über das Gesundheitswesen in der DDR wissen. Immerhin war es ein ganz besonderes. Das große Ziel des sozialistischen Staates: eine Gesundheitspolitik für jedermann - unabhängig von Gehalt und Beruf. Durch eine gute medizinische Versorgung wollte man die Leistungsfähigkeit der Werktätigen erhalten – mit Prophylaxe, Impfplänen und kostenloser Behandlung. Doch es gab immer wieder große Engpässe bei der Versorgung mit Medikamenten und auch beim Personal.
Frank von Olszewski begann 1970 als Hilfskrankenpfleger seine Karriere im Pflegebereich und arbeitete sich bis zum Ausbildungsleiter in der Charité hoch. Anschließend bestimmte er im Berliner Stadtrat die Gesundheitspolitik mit. Über seine Zeit hat er die Bücher „Wie ich zu den Kranken kam” und später „Wie ich durch Bücher Menschen fand” geschrieben. Im Interview hat er uns von seiner Arbeit als Krankenpfleger in der DDR erzählt und uns auch verraten, warum man damals in der Pflege sehr oft improvisieren musste.
Herr von Olszewski, Sie haben nach der Schule erst ein Studium absolviert und als Museologe gearbeitet. Wie kam es dann, dass Sie zur Krankenpflege wechselten?
Ich wollte damals eigentlich schon als Oberschüler in die Medizin gehen. Das ging aber nicht, weil ich keine Zulassung zum Abitur bekam, da ich adliger Abstammung war. So war das damals. Ich habe als Student mal eine kurze Zeit im Altenburger Krankenhaus gearbeitet, fand das hochinteressant, aber ich ging dann zum Studium zurück an die Wartburg. Irgendwie fand ich meine Arbeit dort unergiebig, weil ich bei meinen Führungen bemerkte, dass die Leute kein richtiges Interesse hatten. Dann habe ich eine Annonce in der Zeitung aufgegeben, um einen Job in einem Krankenhaus zu bekommen und es hat geklappt. Nach den ersten drei Wochen wusste ich: Mein Gott, das hättest du schon immer machen sollen. Das war meine Welt.
Sie gingen damals ungelernt als Hilfspfleger ins Krankenhaus und haben sich dann mit Weiterbildungen immer weiter hochgearbeitet. Wie lief denn damals eine klassische Ausbildung ab?
Die offizielle Ausbildung für die Krankenpflege lief über eine Fachschule für Gesundheitswesen in den jeweiligen Kreisen der DDR. Das war ein Fachschulstudium, wo Jungs und Mädels ausgebildet wurden. Erst mal generell, aber natürlich hatten sie auch Russisch, Deutsch, auch Marxismus, Leninismus und so eine Art Staatsbürgerkunde. Den Fachunterricht machten die ansässigen Ärzte, zum Beispiel die Chirurgen oder Augenärzte. Der Unterricht war recht anspruchsvoll und nicht schlecht. Die Lehrlinge wurden dann drei Jahre lang ausgebildet, danach gab es eine Entscheidung, wo sie hinkamen. Meistens konnten sie nach ein oder zwei Jahren in die Spezialisierung gehen, das heißt Anästhesie, OP-Schwester oder Kinderkrankenschwester werden.
Die Pflegeausbildung in der DDR genoss auch im Westen einen guten Ruf und wurde durch die Bezeichnung als Fachstudium aufgewertet. War sie denn wirklich so gut?
Ja, das war sie. Es gab auf jeder Station und in allen Krankenhäusern Lehrschwestern, die begleiteten diese Klassen immer und es wurde akribisch darauf geachtet, dass man lernte, wie das Betten machen und Patienten drehen, das Waschen und Medikamente verteilen funktioniert. Wir haben ja damals noch Medikamente ganz anders verteilt als heute - in Schälchen und Gläschen auf dem Tablett. Aber die Oberschwester und die Ausbildungsschwester haben sehr darauf geachtet. Die Auszubildenden mussten auch alle Praktika machen, also die Chirurgie-Schwester ging auch in die Innere oder in den Kreißsaal und umgekehrt. Jeder wusste vom angrenzenden Fachgebiet immer noch ein bisschen.
Die DDR hatte das Ziel, dass die medizinische Versorgung für jedermann gleich ist. Man wollte erreichen, dass die Menschen lange arbeitsfähig sind. Es gab Impfpläne und die Impfpflicht, Zahnarztbesuche in der Schule - alles bezahlt vom Staat. Warum?
Das Prinzip der DDR war, dass man sich von der tradierten, also der privat orientierten Medizin, abwendete. Ärzte sollten beim Staat angestellt sein, ausreichende Gehälter erhalten, aber eben nicht für sich selbst arbeiten. Krankenhäuser und andere Einrichtungen sind ja vom Staat ernährt worden. Da war natürlich irgendwann der Ofen aus. Ich erinnere mich an einen Sommer, als mir die Oberschwester im Juni sagte: “Du Frank, wir haben eigentlich gar kein Geld mehr. Das ganze Geld für unsere Abteilung ist ausgegeben.” Aber trotzdem machten wir weiter.
Spielte die Politik denn eine Rolle in der Ausbildung oder dem Berufsleben einer Pflegefachkraft?
In der Ausbildung schon. An den Fachschulen wurde auch Russisch und Marxismus unterrichtet. Aber als gelernter DDR-Bürger nahm man das mit einem Ohr auf und schüttelte es aus dem anderen wieder heraus. Und natürlich gab es in den Kliniken auch Parteigruppen. Das spielte schon eine Rolle, aber in der akuten Medizin, im Rettungswesen oder dem OP, da war die Indoktrination nicht ganz so stark.
Die Regierung wollte damals eine Verstaatlichung des Gesundheitswesens. Alleinpraktizierende Ärzte in Praxen sollten zum Auslaufmodell werden. 1950 wurden deshalb sogenannte Polikliniken gebaut. Was hatte es damit genau auf sich? Und warum gibt es sie heute nicht mehr?
Die Poliklinik ist eigentlich eine Einrichtung, die für alle Fälle offen ist. Da konnte jeder hingehen. Dort gab es Ärzte aller Fachrichtungen unter einem Dach wie Chirurgen, Augenärzte, Frauenärzte, Innere Mediziner. In Berlin gab es dann großes Theater um die Abschaffung der Polikliniken und ich habe versucht, den westdeutschen Kollegen zu erklären: “Wir müssen das nicht schließen, das hat mit Russland oder Kommunismus überhaupt nichts zu tun.” Heutzutage schließen sich zehn Leute zusammen und das heißt dann eben Ärztehaus, ist aber im Prinzip nichts anderes. Denn Poli kommt aus dem griechischen und bedeutet “vielfach” und ist ein Haus für unterschiedliche Fachrichtungen.
Auch der Beruf der Gemeindeschwester wurde eingeführt. Was waren die Pflichten und Aufgaben einer Gemeindeschwester?
Sie wurden da eingesetzt, wo Ärzte und Krankenhäuser weiter weg waren - also auf dem platten Land – und handelten im Auftrag des dort niedergelassenen Arztes oder einer landärztlichen Ambulanz. Die Gemeindeschwester kriegte dann den Auftrag, fahr nach A, B oder C und guck nach dem, wechsel hier den Verband oder miss da den Blutdruck. Das war wirklich eine Stütze des Gesundheitswesens. Früher hat das die Kirche gemacht mit der Diakonie. Die DDR hat dann diesen Begriff der Gemeindeschwester eingeführt und ich fand das ausgesprochen sinnvoll und gut.
In der DDR gab es ja immer wieder eine Knappheit von Materialien im Gesundheitswesen, vor allem an Spritzen und Medikamenten. Man wollte zwar eine kostenlose Behandlung für jeden, aber in der Realität herrschten Kostendruck, Planwirtschaft und Mangel. Wie haben Sie das erlebt?
Mit den diesen Umständen fertig zu werden, war schon eine Herausforderung. Wir hatten zum Beispiel nicht genügend OP-Kittel. Die Glasspritzen, die wir hatten, waren wunderbar. Man konnte sie gut sterilisieren und wenn man sie nicht runterschmiss, hatten sie ein langes Leben. Dann kam eine Zeit, da gab es bulgarische Spritzen und da haben wir uns in einer Arbeitsgruppe mal kundig gemacht und gemessen und festgestellt, dass diese eine falsche Skalierung haben. Zehn Milliliter waren hier acht oder auch mal zwölf. Das kann, wenn sie einem Patienten etwas injizieren, schon zu echten Problemen führen. Es konnte auch sein, dass Medikamente nicht da waren, dann hat man sich aber sehr rasch bemüht, wieder welche zu bekommen. Auch Gummihandschuhe waren lange Zeit ziemlich Mangelware. Und was machten wir? Sie wurden nach dem OP eingesammelt und kamen alle in einen Eimer. Dann wurden sie ausgewaschen, getrocknet, anschließend in Talkumpuder gewälzt wie Bratheringe, dann kamen sie in eine Trommel (Anmerkung: ein Gefäß zum Sterilisieren) und dann in ein Dampf-Sterilisierungsgerät. Wenn Sie das heute einem erzählen, der fällt Ihnen ja fast um.
Warum kam es denn überhaupt zu diesen Mängeln in der Versorgung?
Das lag an der gesamten wirtschaftlichen Lage. Unsere Industrie hat das eben nicht geschafft. In West-Deutschland und Amerika gab es dutzende Firmen mit hunderten Mitarbeitern, die Medizintechnik produzierten. Wir hatten im Erzgebirge einen Hersteller, der elektrische Überwachung machte, und wir hatten in Leipzig die Firma Medi, die Beatmungsgeräte herstellte und das war's. Da konnte nicht viel rauskommen und wenn Sie was bestellt haben in Leipzig, dann konnten ein oder zwei Jahre vergehen. Die Planwirtschaft verlangte zwei Jahre vorher immer zu bestellen, damit dann auch eingekauft werden konnte. Auch westliche Produkte, wie zum Beispiel Intubationskatheter. Aber man hat sich auch untereinander ausgetauscht. Ich hatte einen Freund in Weimar, der war Anästhesie-Chef und hatte Zugriff auf westliche Reserven. Dann habe ich ihn dort besucht und ein paar Beatmungsbeutel und Schläuche mitgenommen und hab dann von ihm bekommen, was ich brauchte. Solche Geschäfte sind auch gemacht worden, ohne das es durch irgendeine Buchhaltung ging.
In der DDR war oft nur das Nötigste da, um die Patienten zu versorgen. Aber die Menschen sollen ja damals in der Improvisation sehr kreativ gewesen sein. Haben Sie da ein Beispiel?
Es gab Apotheker, die hatten vorne nicht nur eine Verkaufstheke, sondern die hatten hinten auch Räume. Da wurden Salben angerührt, Säfte hergestellt und auch Pillen gequetscht, zum Beispiel Homöopathisches. Ich hatte mal in einer Zeitschrift ein westliches Medikament entdeckt und gedacht: “Mensch, wenn man das hätte…”. Und dann sagte mein Kollege aus der Anästhesie: “Du, ich werde mal den Apotheker aus Falkensee fragen, wenn der das Rezept hat, dann kann der das.” Dann haben wir ihm die Liste gegeben, er hat das angerührt und wir hatten ein injizierbares Medikament. Das hat der selbst gebastelt. Manche Rentner fuhren in den Westen – Rentner konnten ja in den Westen fahren – und holten dann für ihre Verwandten Medikamente. Die wurden ihnen auch nicht weggenommen, weil man wusste, wir haben das sowieso nicht, also ist schon gut.
Der Westen war immer gut versorgt mit Medikamenten und hatte auch in der Medizintechnik die Nase vorn. Aber gab es etwas, um das die Kollegen aus dem Westen die DDR beneidet haben?
Um die Schwesternausbildung, weil sie anders war. Und sie haben uns um unser Notfallsystem beneidet. Die Bundesrepublik hatte ja in den 1960er- und 70er- Jahren ein Verbundsystem. Wenn ein Notruf kam, fuhr Wagen A hin und guckte: “Ahhh, das ist für uns zu schwierig”. Dann fuhr Wagen B auch hin und guckt auch noch. Richteten sie alle nichts aus, schicken sie dann den Notarztwagen. Da war dann ein Anästhesist oder Chirurg oder Notfallmediziner drin. Das waren drei Autos auf einem Haufen. Bei uns saßen generell in einem Rettungswagen der SMH (Anm.: Schnelle medizinische Hilfe) ein ausgebildeter Arzt, eine Anästhesiekrankenschwester oder -pfleger und ein speziell ausgebildeter Krankenwagenfahrer. Die fuhren zusammen los und wir konnten da vor Ort alles machen. Wir brauchten keinen zweiten Wagen, höchstens wenn wir mehr Verletzte hatten.
30 Jahre nach der Wiedervereinigung kämpfen Pflegekräfte um mehr Anerkennung für ihre Arbeit. Wie sah das in der DDR aus?
Das Ansehen war schon besser. Bei Rettungskräften, aber auch einer OP-Schwester oder einer Stationsschwester. Das ist heute so stark heruntergeschraubt worden, das bedaure ich wirklich. Ich habe es damals nicht erlebt, dass uns nur jemand schief angeguckt hätte. Wenn wir irgendwo in einem Dorf waren zum Beispiel. Dann strömte die Nachbarschaft zusammen und wollte helfen. Das was heute passiert, dass Feuerwehren angegriffen werden oder Schläuche zerschnitten, dass Material geklaut wird, das habe ich nicht erlebt.
Interview: Maja Lietzau




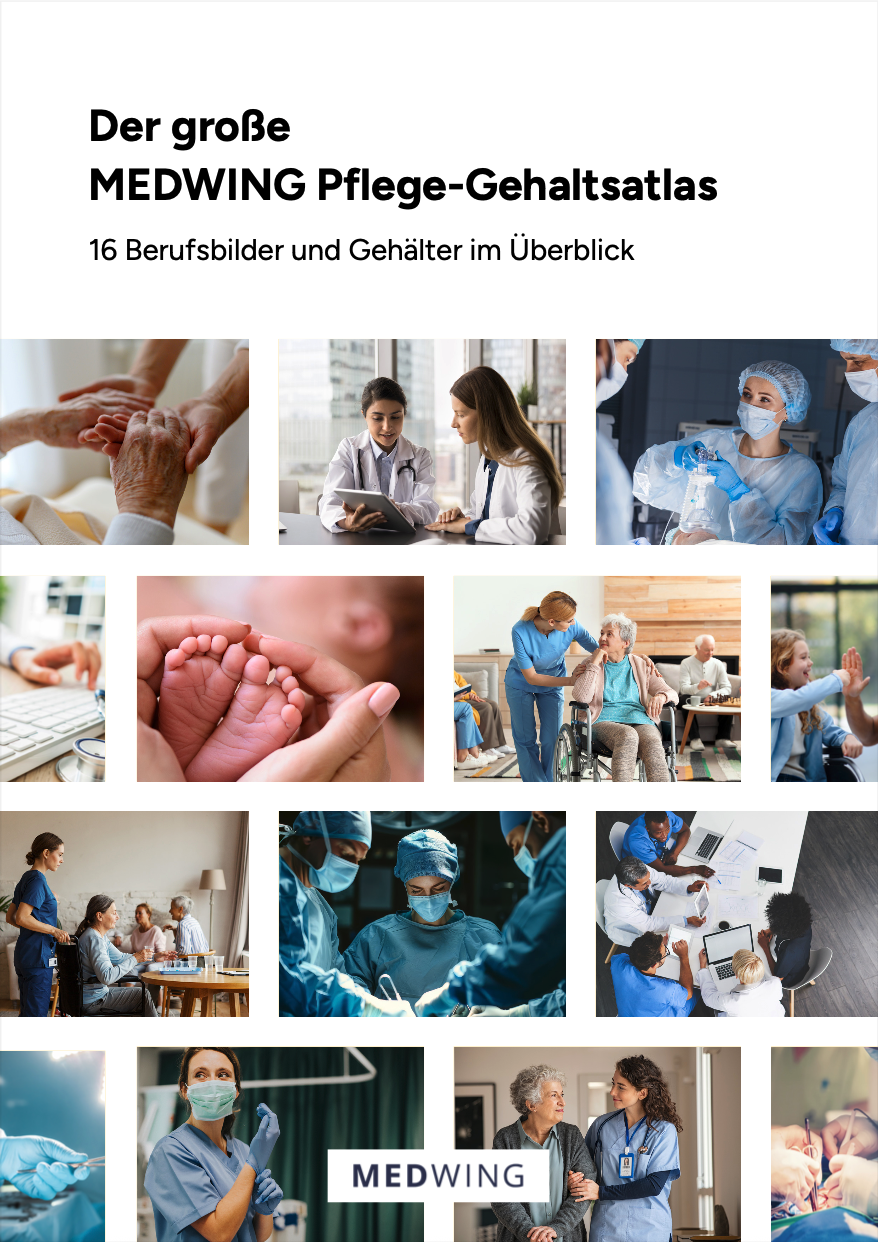
%20(1).png)












.png)