Maßnahmen für Pflegekräfte, Ärzt:innen und Gesundheitsfachkräfte: So reduzieren Einfühlungsvermögen und die richtige Kommunikation Ängste bei Patient:innen.
Ein Krankenhausaufenthalt ist in der Regel für niemanden ein Grund zur Freude. Je nach bevorstehender Therapie sind manche Patient:innen nervöser als andere. Auch die Versorgung in Pflegeheimen, ambulanten Pflegediensten, oder schon die Blutabnahme in der Hausarztpraxis, kann für einige Menschen eine enorme Herausforderung darstellen.
Der Umgang mit solchen ängstlichen Patient:innen ist für Pflegende und Ärzt:innen mitunter sehr schwer. Die richtigen Worte sowie ein empathischer Umgang können hierbei entscheidend für eine erfolgreiche Therapie sein. Im Folgenden erklären wir, wie man ängstliche Patient:innen erkennt und geben Praxis-Tipps für den richtigen Umgang mit ihnen.
Was ist das Besondere an ängstlichen Patient:innen?
Angst kann sich bei Menschen auf unterschiedliche Arten äußern. Manche fangen an zu schwitzen, andere an zu zittern. Auch Weinen oder eine hektische Atmung machen darauf aufmerksam, dass der Körper auf Flucht ausgerichtet ist.
Wenn uns eine Situation Angst macht, wollen wir ihr entkommen. Alles in uns ist auf Alarm programmiert. Kleinkinder folgen oft solchen Instinkten: Sie schreien oder laufen weg. Je älter wir werden, desto mehr sind wir jedoch in unserem Verhalten gesellschaftlich geprägt. Das heißt, wenn wir uns in einer Lage befinden, welche große Ängste in uns weckt, können wir in der Regel nicht einfach flüchten und ihr entkommen.
Wer also eine Spritze bekommen soll, jedoch panische Angst vor diesem Vorgang hat, sieht sich mit einem großen Problem konfrontiert. So ist es für manche Patient:innen beispielsweise ein ganz normaler Vorgang, die morgendliche Heparin-Injektion zu erhalten, während für andere diese Situation mit purer Panik verbunden ist.

Das Problem bei der Sache ist, dass die Therapie diesen Vorgang nun einmal vorsieht. Und von einem erwachsenen Menschen wird erwartet, dass er oder sie nicht aus dem Patientenzimmer flüchtet. Diese Erwartungen können aber zu noch mehr Panik bei ängstlichen Patient:innen führen. „Ich muss das hier durchstehen, aber eigentlich will ich nur weg!“ Diese Gedanken führen zu einer enormen Anspannung. Nicht selten sind dadurch therapeutische Maßnahmen erschwert oder sogar manchmal gar nicht möglich bzw. müssen abgebrochen werden. Dabei kann schon der richtige Umgang mit Angstpatient:innen viel bewirken. Pflegerische Maßnahmen bei Angst sind mitunter ebenso wichtig wie die Behandlung selbst.
Merkmale von Angstpatient:innen
Kein Mensch ist komplett frei von Angst. Sie ist ein Teil von uns und zeigt sich in den unterschiedlichsten Momenten. Und das ist gut so. Denn grundsätzlich soll uns ein extremes Angstgefühl schlichtweg das Leben retten. Simpel ausgedrückt: Ohne Angst hätten unsere Vorfahren womöglich jeden Säbelzahntiger gestreichelt, anstatt vor ihm davonzulaufen.
Ängste haben also unser Überleben gesichert und können uns noch heute vor Gefahren schützen. Wenn aber solche Emotionen im medizinischen Kontext hochkommen und den Therapieerfolg gefährden, müssen Pflegekräfte oder Ärzt:innen intervenieren.
Doch woran erkennt man Angst bei zu behandelnden Menschen? Nicht jeder ist schweißgebadet und „kreidebleich“. So manch einer versteht seine Panik, wenn auch nicht auf Dauer, gut zu überspielen. Angst ist also nicht automatisch sofort ersichtlich. Und der Stress, unter dem Mediziner:innen und Pflegekräfte im Arbeitsalltag häufig stehen, ist dabei nicht gerade förderlich.
Ausgiebige Aufnahmegespräche, bei denen Patient:innen nicht nur interviewt, sondern auch auf ihre Körpersprache hin beobachtet werden können, benötigen Zeit. Und diese ist bekanntlich Mangelware in vielen Einrichtungen. So ist der erste Eindruck oft unauffällig.

Je näher der vermeintliche Eingriff jedoch naht, desto nervöser, unruhiger und auch panischer werden viele Menschen. Ein Indiz dafür, dass sich Angst eingestellt hat, ist für Pflegekräfte oder Ärzt:innen, dass Patient:innen zunehmend Ergänzungen zu ihrer Biografie äußern. Ebenso wird in Unterhaltungen verstärkt und nervös auf die Krankheitsgeschichte eingegangen. Dieses Verhalten ist insbesondere nach der Aufklärung durch Operateur:in oder Anästhesist:in auf chirurgischen Stationen zu beobachten. Allgemein betrifft das Thema Angstpatient eher Personal von Abteilungen, in welchen körperliche Eingriffe durchgeführt werden.
Pflegekräfte sollten sensibel für folgende Angst-Anzeichen sein:
- Atembeschwerden (zum Beispiel beschleunigte Atmung, Gefühl von Brustenge)
- Nervöse Handbewegungen
- Schweißausbrüche
- Beschleunigter Puls
- Schwindel
- Unkontrollierte Kommunikation
- Übelkeit
- Angespannte Körperhaltung
- Akutes, teilweise unerwartetes Einsetzen von Angst- und Paniksymptomen (zum Beispiel nach Aufklärungen/vor Operationen)
- Plötzliche Ergänzungen zu Biografie und Krankheitsgeschichte
So reduzieren Gesundheitsfachkräfte Angst schon im Vorfeld durch das richtige Verhalten
Vorausgesetzt, es besteht keine diagnostizierte Angststörung, können Angstpatient:innen durch den richtigen Umgang sehr gut beruhigt werden. Gesundheitsfachkräfte können mit Einfühlungsvermögen entgegenwirken, wenn beim Patienten Panik ausbricht.
Dabei gibt es diverse Möglichkeiten den Patient:innen schon vorweg ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Auf diese Weise werden Ängste schon im Vorfeld „im Zaum“ gehalten:
- Patient:innen immer über alle anstehenden Behandlungsschritte informieren.
- Das Gefühl vermitteln, dass Bedenken und Sorgen ernst genommen werden (dabei nicht nur so tun als ob, sondern auch so agieren).
- Frühzeitig auf Angstsymptome achten und nicht als unwichtig abtun.
- Schon beim Pflegeprozess auf die Möglichkeiten zu Gesprächen mit den behandelnden Ärzt:innen aufmerksam machen.
- Für Transparenz in der Behandlung sorgen (zum Beispiel verständliche Ausdrücke verwenden, keine Fachbegriffe oder Abkürzungen).
- Sicherheit ausstrahlen.
- Vertrauen aufbauen und Kooperation sichern.
- Den Patient:innen das Gefühl von Kontrolle und Selbstbestimmung geben.
- Angehörige nicht ausschließen, sondern in die Behandlungen einbinden (wenn von Patient:innen erwünscht).
- Nichts verharmlosen, sondern Emotionen der zu Behandelnden ernst nehmen (also keine Sätze wie „Das ist doch gar nicht schlimm“ oder „Sie brauchen keine Angst haben“).
- Als Pflegefachperson die eigenen Ängste kennen und reflektieren. Ssicherstellen, dass diese nicht in die pflegerische Behandlung einfließen, zum Beispiel durch Gedanken wie „Mich würden Sie niemals in so eine Röhre bekommen!“.
- Nach Möglichkeit physische Behandlungen zur Beruhigung und Entspannung anbieten (zum Beispiel Aromatherapie, Einreibungen oder leichte Massagen).
Was tun, wenn die Angst da ist?
Folgende Punkte stellen sich als sehr hilfreiche heraus, um schwierige Situationen in den Griff zu bekommen:
- Empathie und Verständnis zeigen.
- Vermitteln, dass Angst in dieser Situation nichts Ungewöhnliches ist und kein Grund zur Scham besteht.
- Keine Diskussionen oder Argumentationen, welche die Patient:innen noch zusätzlich unter Druck setzen und bedrängen.
- Starke Ängste unbedingt ernst nehmen und zuständige Ärzt:innen informieren. Gegebenenfalls abklären, ob geplante Behandlungsschritte unter den vorliegenden Umständen möglich, beziehungsweise nötig sind.
- Auch in panischen Situationen Ruhe und Sicherheit ausstrahlen (einen Halt geben).
- Ruhige und verständnisvolle Kommunikation beibehalten.
Arztphobie
Die Zeit, in der Ärzt:innen als „Götter in Weiß“ angesehen wurden, gehört längst der Vergangenheit an. Offene Gespräche auf Augenhöhe sollten bei einem Arztbesuch, bei Visiten oder Aufklärungsgesprächen eine Selbstverständlichkeit sein.
Dennoch, nicht wenige Menschen graust es vor der Konfrontation mit Mediziner:innen. Die Gründe sind vielfältig. Zu ihnen zählen unter anderem:
- Negative Erfahrungen
- Angst vor dem Unbekannten
- Furcht vor Schmerzen
- Angst vor Kontrollverlust
- Scham vor dem eigenen Körper
- Scham bezüglich der eigenen Schwächen (z.B. Adipositas, Rauchen)
Die eigene Gesundheit einer fremden Person anzuvertrauen ist nicht leicht. Für viele Patient:innen besteht Unsicherheit, die sich schnell zu Angst oder einer wahren Arztphobie wandeln kann. Einige Betroffene können offen über dieses Phänomen reden. Aber viele sehen sich hierzu nicht in der Lage und versuchen ihre Emotionen so lange wie möglich zu überspielen.
Um schnell und professionell mit solchen Situationen umzugehen, müssen Ärzt:innen hierfür sensibilisiert sein. Statt auf die typischen extremen Angstanzeichen wie Zittern und Schwitzen sollten gerade die behandelnden Ärzt:innenen auf weitere Anzeichen achten. Denn während so mancher Patient vor Pflegenden vielleicht eher die Fassung verliert, versuchen viele gerade im Arztgespräch so lange wie möglich nicht „ihr Gesicht zu verlieren“.
Ängste zeigen sich in diesem Fall unter anderem wie folgt:
- In sich gekehrt sein
- Anscheinende Teilnahmslosigkeit
- Krampfhafter Versuch, sich nichts anmerken zu lassen
Ärzt:innen sollten bei Verdacht auf starke Ängste sofort näher auf ihre Patient:innen eingehen und das Gespräch suchen. So können sie sicherstellen, ob sich Vermutungen bestätigen und sie dementsprechend handeln müssen.
Wer als Arzt oder Ärztin den richtigen Umgang gegenüber Angstpatient:innen ernst nimmt, sollte auf die folgenden Punkte achten:
- Befürchtungen ansprechen und Raum geben, diese ohne Scham zu äußern.
- Ängste, egal welcher Form, nicht kleinreden oder abtun.
- Sicherheit und Vertrauen vermitteln.
- Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen.
- Lange Wartezeiten vermeiden.
- Persönliche Betreuung und freundlicher Umgang (auch durch andere Mitarbeiter:innen, zum Beispiel dem Praxisteam).
- Langsam an die Situation heranführen.
- Patient:innen nicht überfordern.
- Nichts ohne Erklärung durchführen.
- Alles, was von der Angst ablenkt ist erlaubt (zum Beispiel Zeitschriften, Bildschirm etc.)
- Wünsche ermöglichen (früher Termin etc.)
Ob nun das Kind, das zu schreien beginnt, wenn es eine Spritze sieht oder der 40-jährige Mann der schweißgebadet auf dem Behandlungsstuhl in der Zahnarztpraxis sitzt – sie alle zeigen uns, dass Ängste in Pflege und Medizin allgegenwärtig sind.
Wichtig ist es, den Betroffenen zu zeigen, dass ihre Befürchtungen ernst genommen werden. Viele Ängste resultieren aus Unsicherheit, Hilflosigkeit oder schlechten Erfahrungen. Dabei hilft Kontrolle gegen Angst. Patient:innen sollten wissen, dass sie nicht ausgeliefert sind, sondern ein Recht auf Aufklärung und Mitentscheidung haben. Ein empathisches Entgegenkommen, Verständnis und schon ein ernst gemeintes, freundliches Lächeln sind dabei ebenso wichtig, und helfen Ängste zu reduzieren und Therapien auf bestem Weg für alle zu ermöglichen.
Sarah Micucci




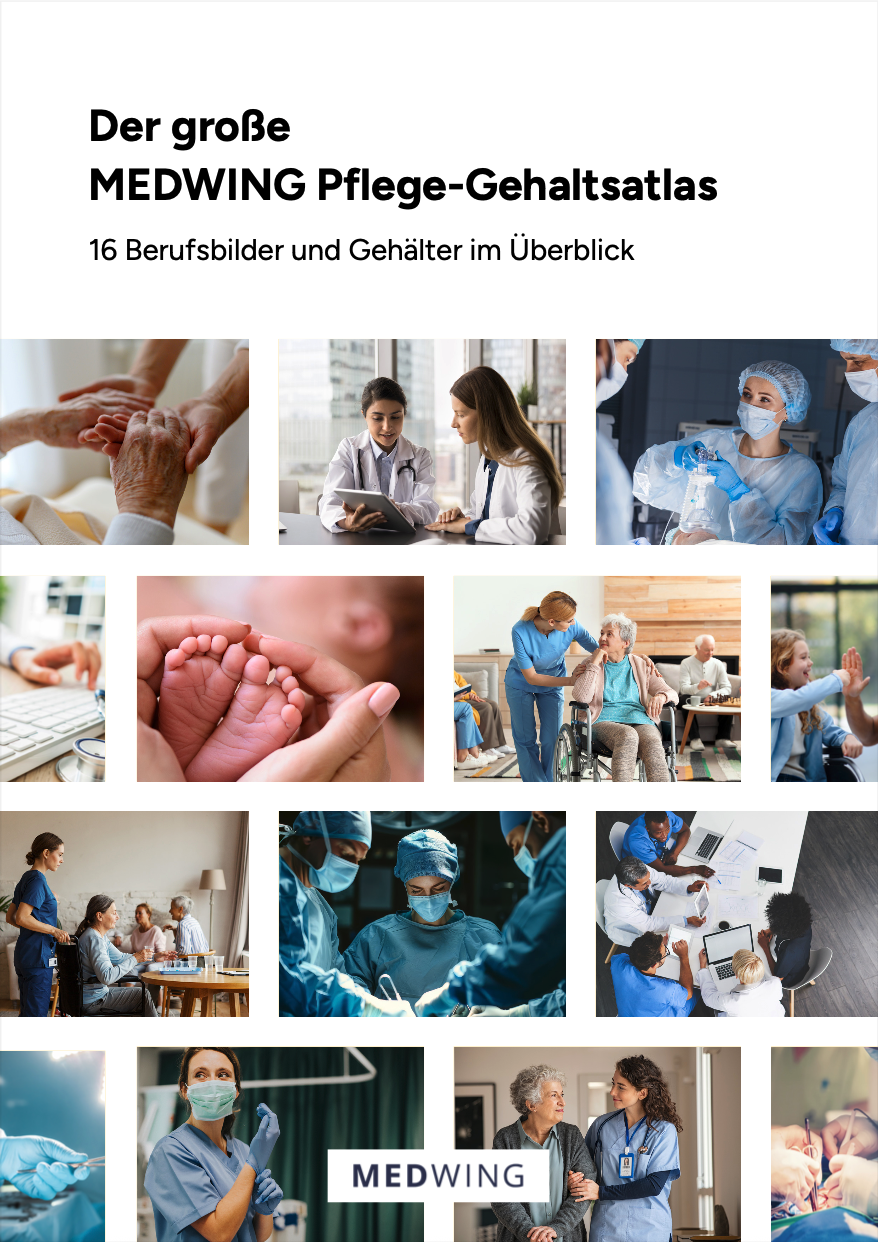
%20(1).png)












.png)